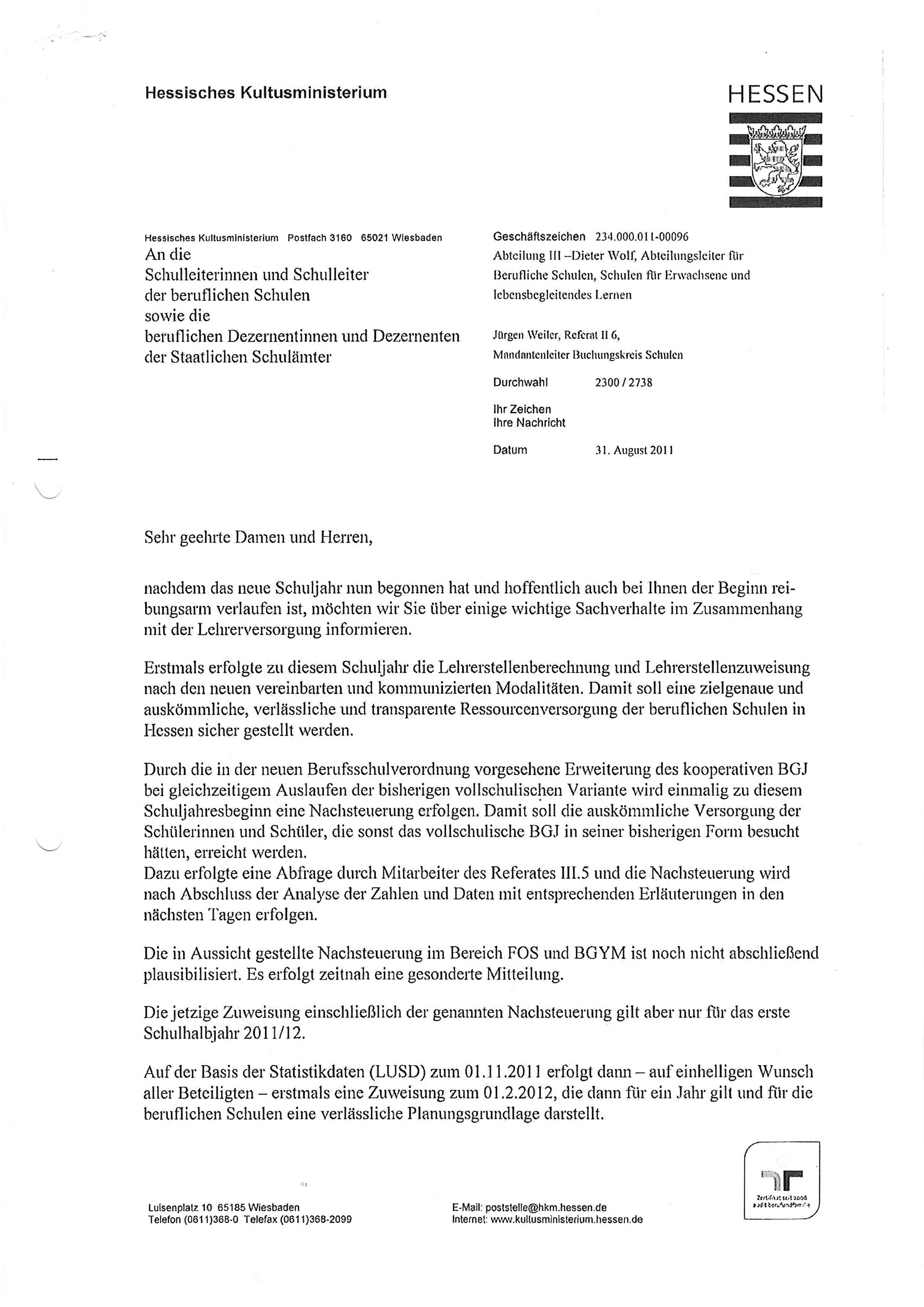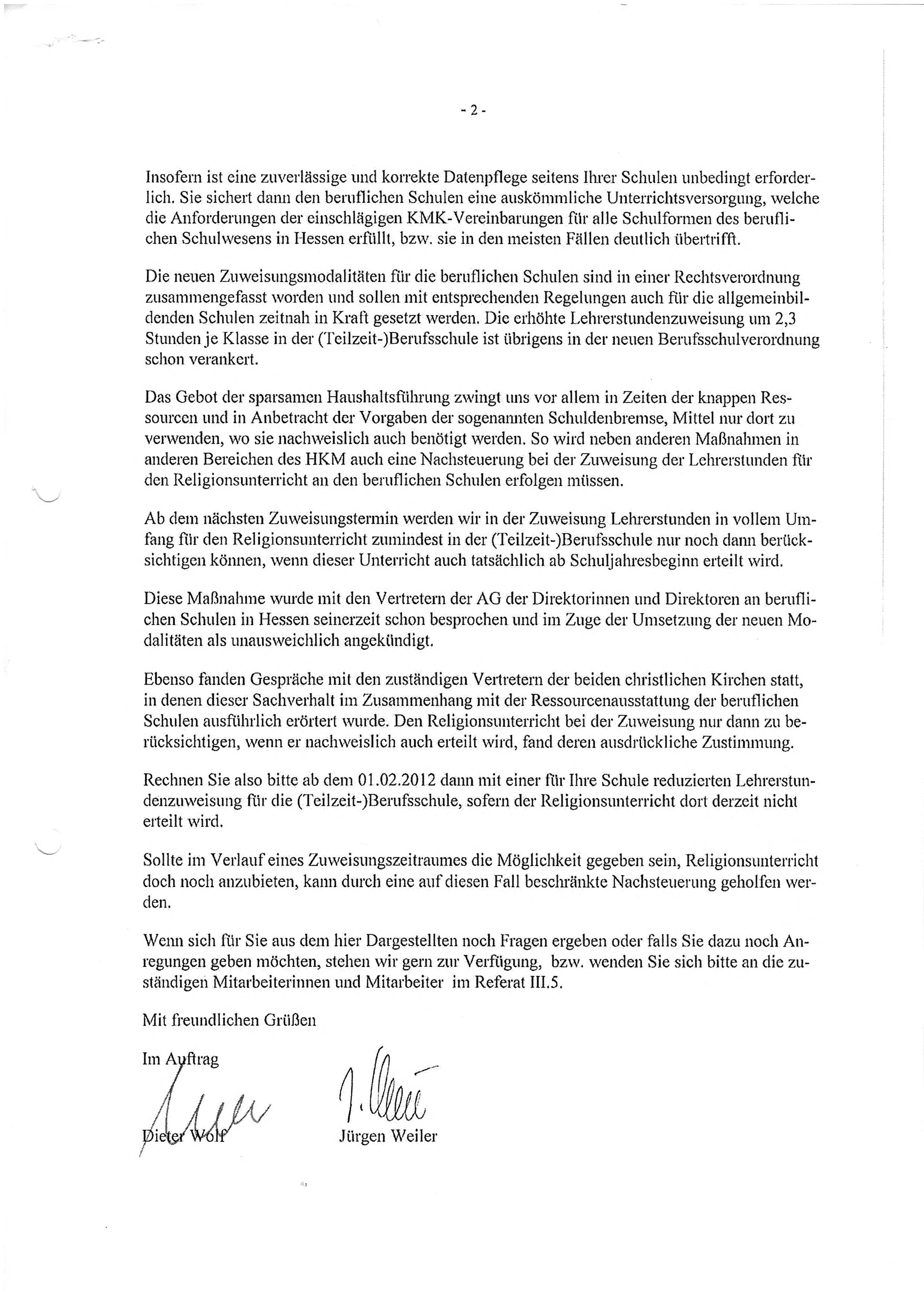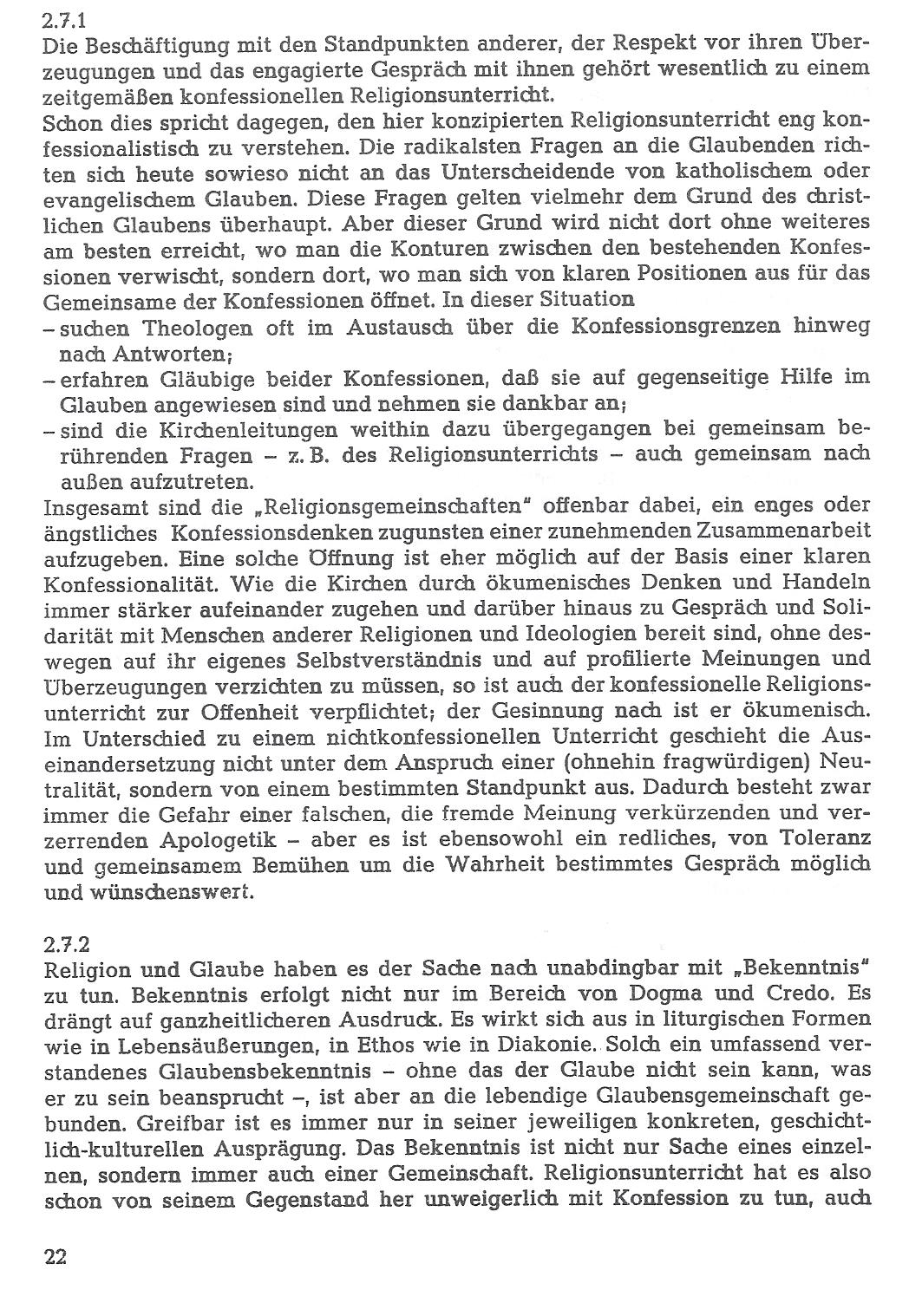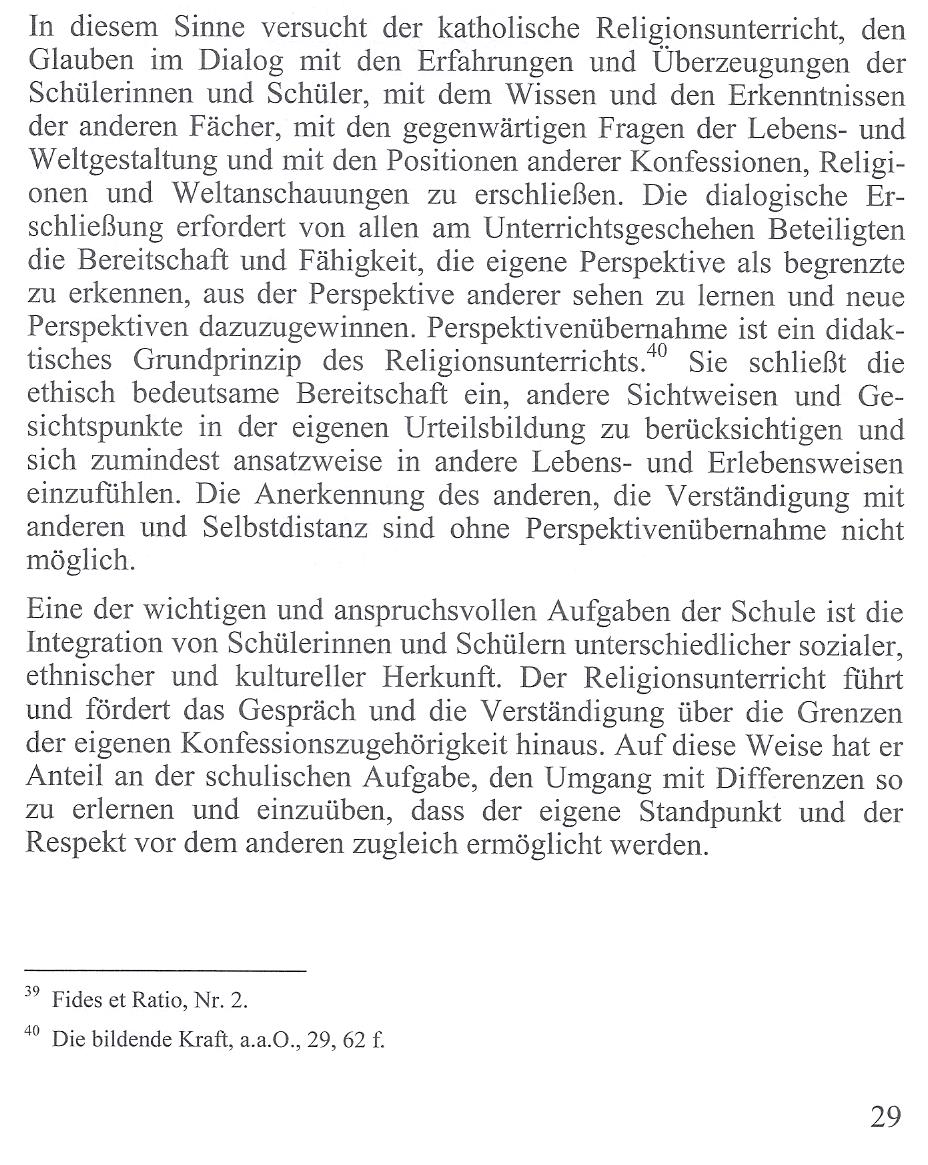Erlass vom 03. September 2014 (gültig ab 01.01.2015)
VII.
Ausnahmen bei der Bildung von Lerngruppen im
evangelischen und katholischen Religionsunterricht
1. Ist in einem Schuljahr die Bildung von Lerngruppen für beide Konfessionen gemäß Abschnitt V Nr. 1 und Abschnitt VI Nr. 1 nach ergebnisloser Durchführung des Verfahrens nach Abschnitt IV zum Beispiel wegen Mangel an Lehrkräften oder wegen schulorganisatorischer Schwierigkeiten nicht möglich, können die Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht jeweils der anderen Konfession unter folgenden Voraussetzungen teilnehmen:
a) Die Schulleitung beantragt unter Angabe von Gründen die Zustimmung zur Erteilung von Religionsunterricht in einer konfessionell gemischten Lerngruppe über die untere Schulaufsichtsbehörde bei den zuständigen Behörden beider Kirchen (siehe Anlage). Sie fügt eine Stellungnahme der beiden Fachkonferenzen, soweit sie bestehen, sowie das Einverständnis der betroffenen Religionslehrerinnen und Religionslehrer bei.
b) Nach Zustimmung der kirchlichen Behörden informiert die Schulleitung die
Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht der anderen Konfession
Teilnehmen können, und deren Eltern (§ 100 des Hessischen Schulgesetzes).
2. Grundlage des Unterrichts ist das jeweilige Kerncurriculum oder der jeweilige Lehrplan. Bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte sollen die konfessionellen Besonderheiten und Prägungen mit dem Ziel gegenseitigen Verstehens behandelt werden.
Verlautbarungen:
a. Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland: Der Religionsunterricht in der Schule (1974)
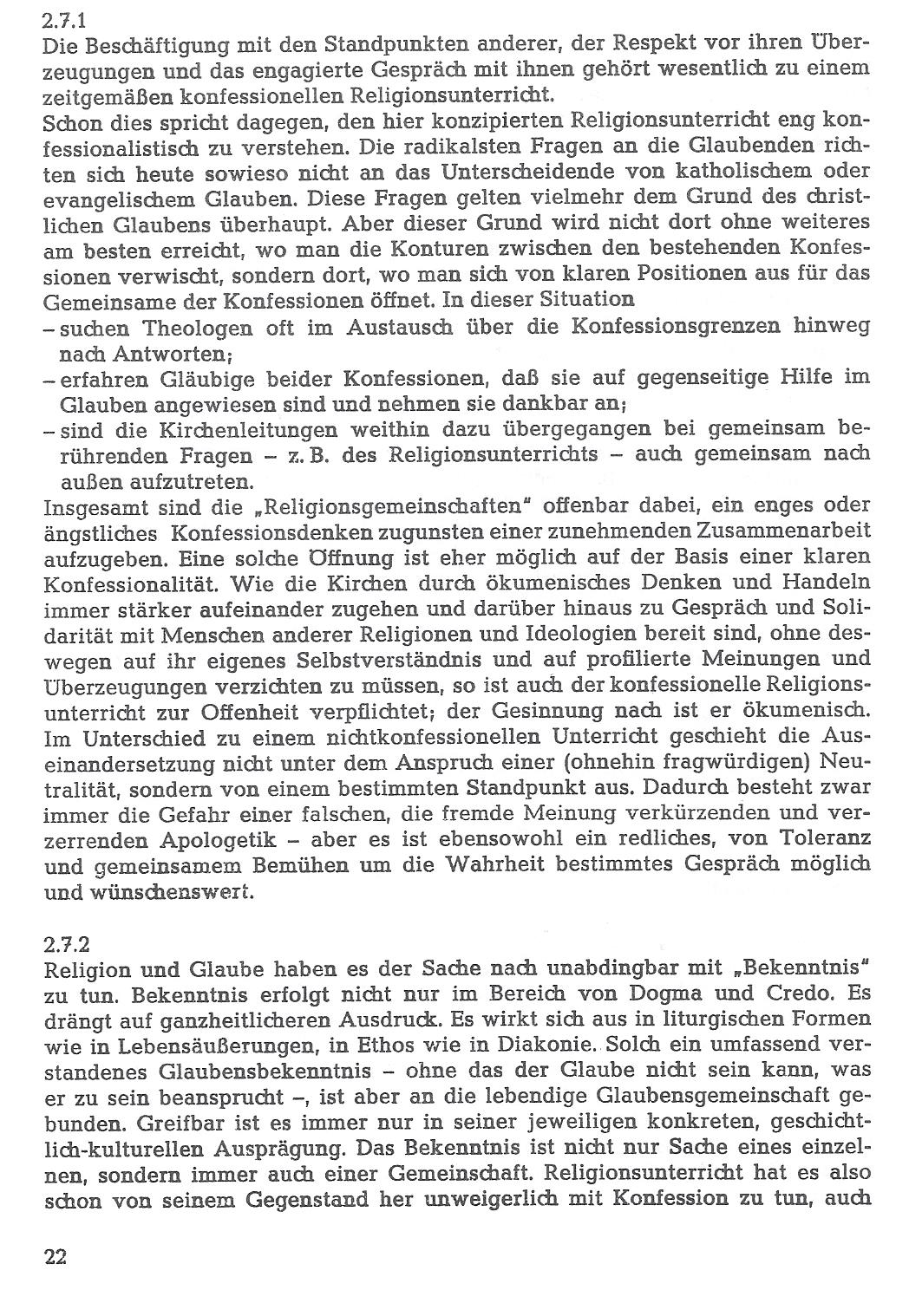
b. Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Die deutschen Bischöfe. Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (2005).
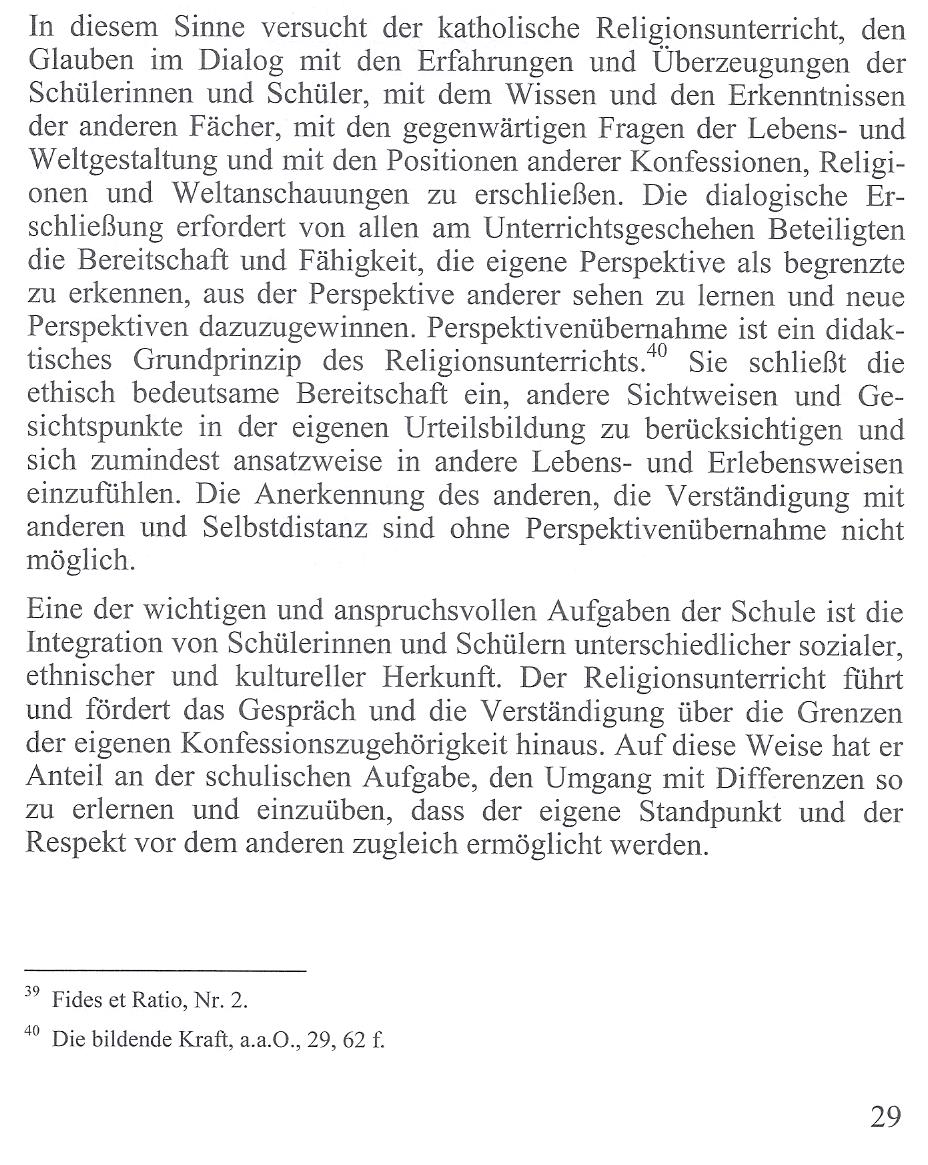
c. Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD): Zur Kooperation von Evangelischem und Katholischem Religionsunterricht, 1998
(www.ekd.de/download/konfessionelle_kooperation_1998.pdf)
I. Grundlagen
- Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat 1994 in der Denkschrift „Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts in der Pluralität“, die deutschen Bischöfe haben 1996 in ihrer Erklärung „Die bildende Kraft des Religionsunterrichts. Zur Konfessionalität des katholischen Religionsunterrichts“ die jeweiligen Positionen zu Sinn, Aufgaben und Gestalt des Religionsunterrichts im Rahmen des Bildungsauftrages öffentlicher Schulen dargelegt.
- In beiden Schriften wird mit unterschiedlichen, aber vergleichbaren Begründungen die Konfessionalität des Religionsunterrichts betont. Übereinstimmung besteht darin, dass konfessioneller Religionsunterricht immer auch in ökumenischem Geist erteilt wird. Bei der Kooperation von evangelischem und katholischem Religionsunterricht sind sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen zu beachten, die in den beiden Schriften aufgezeigt werden.
II. Formen der konfessionellen Kooperation
Im Sinne der gemeinsamen Grundlagen können folgende Formen der konfessionellen Kooperation genutzt werden:
1. In der schulischen Praxis:
gemeinsame Elternabende zum Religionsunterricht,
- wechselseitiger Gebrauch von Unterrichtsmaterialien und Schulbüchern zu bestimmten Themen,
- Zusammenarbeit bei Stoffverteilungsplänen,
- Zusammenwirken der Fachkonferenzen,
- Einladung der Religionslehrerin bzw. des Religionslehrers der je anderen Konfession in den eigenen Religionsunterricht zu bestimmten Themen und Fragestellungen,
- zeitweiliges team-teaching von bestimmten Themen oder Unterrichtsreihen,
- gemeinsame Unterrichtsprojekte und Projekttage,
- Einladung der Pfarrerin bzw. des Pfarrers oder anderer Vertreter der je anderen Konfession in den Religionsunterricht,
- Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schulpastoral/Schulseelsorge,
- gemeinsame Gestaltung von schulischen und kirchlichen Feiertagen, von Schulgottesdiensten, Andachten, Schulfeiern u.a.,
- konfessionell-kooperative Arbeitsgemeinschaften auf freiwilliger Basis als zusätzliches Angebot.
2. Auf der Ebene der Schulverwaltungen:
- Abstimmung und Zusammenarbeit bei der Erarbeitung von Lehrplänen,
- Entwicklung gemeinsamer Unterrichtsmaterialien durch Fachleute beider Konfessionen.
3. In der Lehrerbildung: – 2 –
3.1 Im Vorbereitungsdienst (Referendariat):
- gemeinsame Arbeitssitzungen der Verantwortlichen für den Vorbereitungs-dienst,
- gelegentliche gemeinsame Seminartreffen und Veranstaltungen,
- Entwicklung und Reflexion kooperativer Modelle,
- Planung und Durchführung konfessionell-kooperativer Unterrichtselemente.
3.2 In der Fortbildung:
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der je anderen Konfession,
- Planung und Durchführung von Fortbildungen unter Mitwirkung von Referentinnen und Referenten der anderen Konfession,
- Planung und Durchführung gemeinsamer Fortbildung zum Themenbereich konfessionelle Kooperation.
Die Einführung solcher Kooperationsformen setzt voraus, dass sowohl evangelische als auch katholische Kooperationspartner vorhanden sind. Neben der Zustimmung der unmittelbar Beteiligten muss die Zustimmung der zuständigen kirchlichen Stellen gewährleistet sein.
III. Weitere Möglichkeiten des konfessionellen Religionsunterrichts
1. Regionale Gegebenheiten, schulformspezifische Besonderheiten und schul-reformerische Herausforderungen legen Kooperationsformen nahe, die über die oben genannten hinausgehen, z.B. in den östlichen Bundesländern, in Diasporagebieten oder bei Sonder- und Berufsschulen.
2. Für einen Religionsunterricht in ökumenischem Geist stellt sich daher auch die Frage der Teilnahme von Schülern und Schülerinnen am Religionsunterricht der jeweils anderen Konfession. Evangelischer Religionsunterricht macht die Zugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler zur evangelischen Kirche nicht zur Teilnahmebedingung. Dies versteht sich allerdings unter der Voraussetzung, dass für evangelische und katholische Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dem Grundgesetz gemäß Religionsunterricht in ihrer Konfession angeboten wird und sie in der Regel an diesem teilnehmen. Für den Katholischen Religionsunterricht gilt, dass über die Konfessionszugehörigkeit der Lehrenden und die Bindung der Inhalte des Religionsunterrichts an die Grundsätze der Kirche hinaus auch die Schülerinnen und Schüler der katholischen Kirche angehören. Am Katholischen Religionsunterricht können jedoch in Ausnahmefällen Schüler und Schülerinnen einer anderen Konfession teilnehmen insbesondere dann, wenn der Religionsunterricht dieser Konfession nicht angeboten werden kann.
Für beide Kirchen ist die Teilnahme konfessionsloser Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht möglich.
3. Diesbezügliche Regelungen in den Bundesländern bedürfen einer Vereinbarung zwischen den betroffenen Diözesen, Landeskirchen und Landesregierungen. Sie dürfen nicht aus schulorganisatorischen Gründen angeordnet werden; das gilt gerade auch dann, wenn Schülerinnen und Schüler einer Konfession eine Minderheit an der Schule bilden. Die Verfahrensweisen sind genau zu bestimmen. Eltern bzw. die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Schulleitung sind in geeigneter Form zu beteiligen. Das Profil des jeweiligen konfessionellen Religionsunterrichts muss gewahrt bleiben. Zeitlich befristete Erprobungen – eventuell mit wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung – können sinnvoll sein. Ihre Ergebnisse sollen den kirchlichen Schulverwaltungen rückgemeldet werden.
Würzburg, im Januar 1998 Hannover, im Februar 1998
Zur Denkschrift „Religiöse Orientierung gewinnen“ auf der Seite der EKD